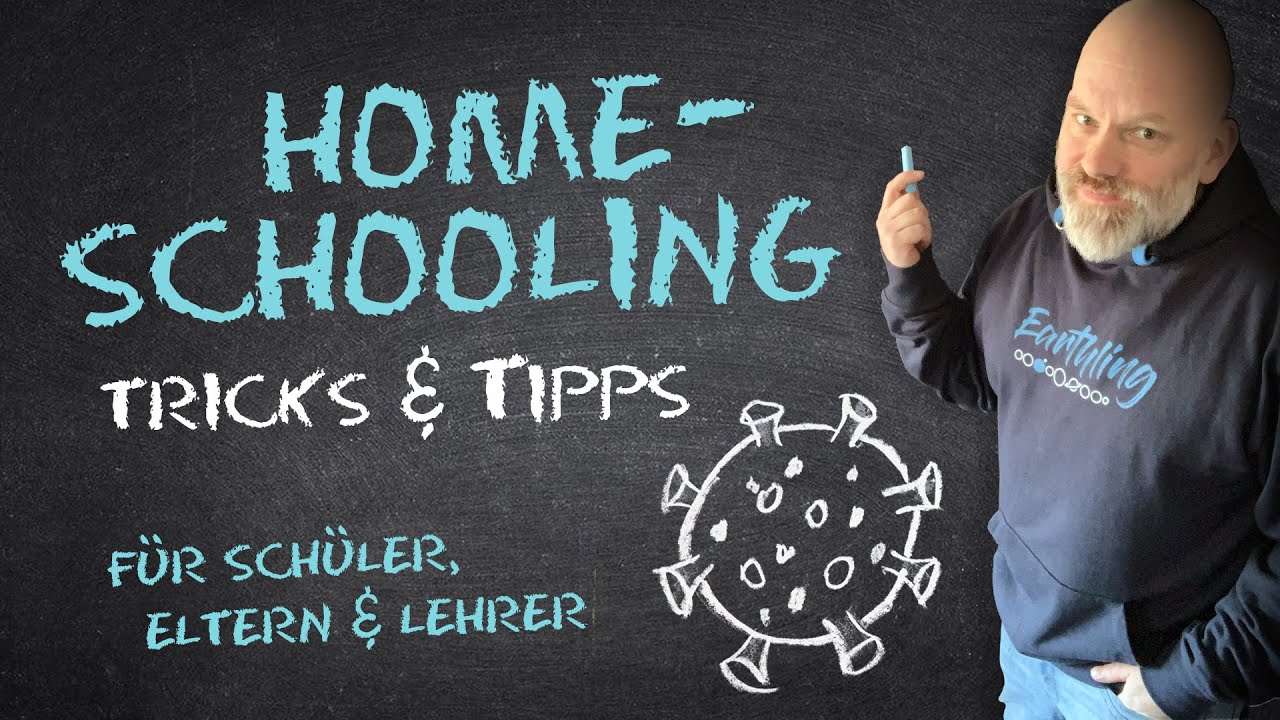Ich glaube, Angst ist die schlechteste und zugleich verlässlichste Begleiterin in einer Pandemie. Sowohl im Kleinen, im Persönlichen, als auch im Großen, im Gesellschaftlichen, Globalen. Auch mich hat ein Gefühl von Angst ergriffen als mir klar wurde, dass es sich bei Corona um eine tückische Pandemie handelt, die mich und jede*n andere*n direkt betrifft. So ganz verloren habe ich diese Angst nicht. Seitdem ich akzeptiert habe, dass ich sie nicht loswerde, versuche ich lediglich mit ihr zu leben. Oder genauer gesagt, ich versuche es bei der Angst zu belassen. Keine Panik aufkommen zu lassen. Ich gebe mir seit mehreren Monaten Mühe, meine Ängste zu erkennen, ihre irrationalen Teile ausfindig zu machen und zu benennen. Auch gegenüber anderen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. So wie bei den meisten Dingen im Leben.
Aber ich hasse es, dass meine Angst derart sichtbar ist. Als Künstler bin ich es gewohnt mit unsicheren Situationen und Ängsten umgehen zu müssen, mich ihnen immer wieder zu stellen. Aber für gewöhnlich mache ich das mit mir selbst oder Vertrauten aus. Die Pandemie zwingt mich dazu mich öffentlich zu meiner Angst zu bekennen. Nicht weil es keine anderen Wege gäbe, sondern weil ich sonst nicht mit ihr klarkäme. Sie würde schlicht mein Leben übernehmen, meine Vernunft ausschalten, mich irrational, vielleicht radikal handeln lassen. Die Angst würde sich in meinem Körper breitmachen. So wie sie es zwischenzeitlich während der Pandemie getan hat. Sie hat sich in meinem Nacken festgesetzt, in meinen Schultern, hat meine Muskulatur verkrampfen lassen als ich begriff, dass etwas Unberechenbares und Ungutes auf uns zukam, das unser Leben verändern und möglicherweise unsere Existenzgrundlage bedrohen würde. Sie hat mir den Atem geraubt und mich über Wochen körperlich ermüdet, als ich keinen Ausweg aus meiner pandemiebedingten beruflichen Krise finden konnte. Und bis heute ergreift sie mich in einer unangenehm stressigen Art von Anspannung, wenn ich Einkaufen gehe, was ich selbst im selbstgewählten Lockdown seit Oktober tun muss.
Um die Angst im Griff zu haben, muss ich offen mit ihr umgehen. Das bedeutet, derjenige zu sein, der die Maske aufzieht, wenn mir die Ansteckungsgefahr zu ungewiss ist, auch wenn alle anderen noch sorglos sind. Im Freien zum Beispiel, wenn niemand auf Abstand achtet. Es heißt, abschätzige Blicke zu spüren und bestenfalls zu ignorieren, wenn ich Menschen aus dem Weg gehe, die mir im Supermarkt zu nahekommen. Ich könnte es auch Vorsicht nennen, aber das wäre unehrlich. Das Gefühl, dass ich dabei habe, ist Angst. Konflikte einzugehen ist ebenso Teil dieser Offenheit im Umgang, auch wenn diese, selbst freundlich geführt, als Angriff verstanden werden. Manchmal aber schlägt auch meine Angst in Aggression um. Zum Beispiel als ich in eine Apotheke kam und die Apothekerin sich vor der Verkaufstheke im Kundengespräch befand. Sie und die Kundin, beide maskenlos. Ich schwieg zunächst und ging zum Tresen, um bei der Kollegin mein Rezept einzulösen. Meine Blicke müssen deutlich gemacht haben, was ich von der Situation hielt. Aber niemand reagierte. Ich blieb der Einzige mit Maske in der Apotheke und bemerkte, wie die Wut in mir hochkochte. Über die Unvernunft von Menschen, die es nun wirklich besser wissen mussten, und die Rücksichtslosigkeit der Anwesenden. „Nur noch schnell raus hier“, dachte ich und machte mich ohne Verabschiedung auf den Weg nach draußen. Doch kurz vor der Tür lief mir die maskenlose Kundin direkt in die Arme und meine aufgestaute Wut entlud sich. Ich schrie alle drei an, was für ein unverantwortlicher Haufen sie seien und dass ich nicht für möglich gehalten hätte, dass mir so etwas in einer Apotheke widerfahren könnte. Bewirkt hat mein Ausbruch bis auf Unverständnis nichts. Niemand setzte eine Maske auf und die E-Mail, die ich zuhause an die Apotheke schrieb, blieb unbeantwortet.
Es macht einfach mehr Sinn, sofort und ruhig mein Recht auf körperliche Unversehrtheit einzufordern. „Bitte halten Sie Abstand“ oder „Entschuldigung, Ihre Maske ist verrutscht“ führt zwar oft zu aggressiven Reaktionen, aber dann kommt sie von meinem Gegenüber. Manchmal ist es nur ein mürrisches Brummen. Ein anderes Mal kann es ein hasserfülltes „Heil Merkel“ sein, dass entgegengebrüllt wird, wie es meinem Mann widerfuhr, als er darum bat, zwei Kunden im Supermarkt mögen bitte Masken tragen. Aber mir ist diese Aggression, solange sie nicht körperlich wird, lieber als die abschätzigen Blicke. Denn hinter der zur Schau gestellten Herablassung lässt sich die Angst leichter verstecken. Wenn sie mich mit wütendem Gesicht Schlafschaf oder Maulkorbaffe nennen, kann ich die Angst der anderen besser sehen. Ihre Angst, die sie dazu verleitet hat, die Gefahr zu ignorieren, ganz gleich, wie schlimm das Ausmaß der Pandemie gerade ist. Die verdrängte Angst, die sie irrational werden lässt, die den Kopf regelrecht in den Sand rammt. Diese Angst, vielleicht schon eine unbewusste Panik, zu sehen, bestärkt mich in meinem Weg der Offenheit. Deswegen sind mir ihre Aggressionen lieber als ihre herablassenden Blicke.
Ich kann die Ängste verstehen, die diese Menschen antreibt. Das haben wir gemeinsam. Aber durch ihre Weigerung, sich ihren Ängsten zu stellen, gefährden sie sich und andere. Und diese Weigerung der Unvorsichtigen und Coronaleugner kann ich nicht akzeptieren. Letztlich ist es die Angst und der Umgang mit ihr, was uns in der Pandemie spaltet. Sollte ich den Empathielosen empathisch begegnen? Auch, wenn sie unter Umständen mein Leben gefährden?
Ich weiß noch nicht, wem ich was verzeihen kann. Ein Stück Misstrauen wird wohl bleiben.
HS
Header by Prawny